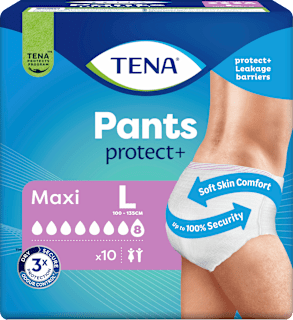Inkontinenz
Gehen Ihnen bisweilen ein paar Tröpfchen verloren, wenn Sie niesen, lachen oder etwas Schweres heben? Damit sind Sie nicht allein. In Österreich ist Statistiken zufolge etwa jeder Zehnte von Inkontinenz betroffen, wobei die schwache Blase bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern. Obwohl Harninkontinenz weit verbreitet ist, sprechen viele Betroffene allenfalls mit dem Arzt oder der Ärztin darüber. Das trägt zur völlig unnötigen Tabuisierung des Themas bei: Hier erfahren Sie, was Inkontinenz ist, wie sie entsteht und was Sie dagegen tun können.

dm drogerie markt
Lesedauer 7 Min.
•
10.12.2025

Was ist Inkontinenz?
Als Harninkontinenz bezeichnet man die gestörte oder fehlende Fähigkeit, Urin zu halten. Es handelt sich medizinisch gesehen um eine Speicherstörung der Harnblase, die diverse Ursachen haben kann. Der Begriff „Inkontinenz“ kommt aus dem Lateinischen: „In“ (un-) und „continentia“ (zurückhalten).
Wann tritt Inkontinenz auf?
Zwar kommt derartige Blasenschwäche bei Frauen, durch hormonelle Schwankungen bedingt, in den Wechseljahren vermehrt vor. Beeinträchtigungen der Blasenfunktion treten jedoch in jedem Lebensalter auf. Stark verbreitet sind sie bei pflegebedürftigen Personen und Demenzpatienten (sogenannte „funktionale Inkontinenz“). Allerdings muss es sich bei Problemen mit dem Harndrang keinesfalls um eine chronische Funktionsstörung handeln. Linderung und Heilung sind oft möglich.
Verschiedene Formen der Inkontinenz
Das Ausmaß der Inkontinenz ist individuell. Es reicht von wenigen Tröpfchen bis zum schwallartigen Abgang von bis zu 300 Millilitern. Ein Urinverlust zwischen 50 und 200 Millilitern gilt als „mittlere Inkontinenz“. Darüber hinaus unterscheiden Urologen verschiedene Ausprägungen.
- Belastungs- oder Stressinkontinenz: Es besteht ein „Defekt“ am Schließmuskel der Harnröhre. Das führt dazu, dass bei mechanischen Belastungen (Lasten heben, Treppen steigen, heftiges Husten oder Lachen) die Harnröhre nicht ausreichend verschlossen und durch die Bewegung im Bauchraum Urin abgelassen wird. Wichtig: Die organische Harnblasenfunktion selbst ist bei dieser Form der Inkontinenz nicht gestört; das Problem ist, salopp gesagt, die „Dichtung“.
- Dranginkontinenz: Dabei ist die harnaustreibende Muskulatur die Ursache. Es kommt zu vermehrtem und teils anfallsweise auftretendem Harndrang, der Betroffenen kaum die Zeit lässt, rechtzeitig eine Toilette zu erreichen. Trotzdem ist die Blase dabei oft nicht annähernd gefüllt.
- Reizblase: Hier tritt der Zwang zum Wasserlassen ungewöhnlich häufig und besonders nachts auf, es wird aber stets nur wenig Urin ausgeschieden. Im Unterschied zur Dranginkontinenz ist spontaner Urinverlust eher selten, da Betroffene durchaus Kontrolle über die Blase haben.
- Überlauf-Inkontinenz: Das ist eine Entleerungsstörung, bei der sich die Harnblase nicht vollständig entleert. Aufgrund dessen geht in kurzen Abständen immer wieder etwas Urin verloren.
- Mischinkontinenz: Es existieren ferner unklare Ausprägungen der Inkontinenz bei Frauen und Männern, bei denen gleich mehrere der oben beschriebenen Auslöser gegeben sind.
Welche Ursachen hat Inkontinenz?
Es kommen im Wesentlichen zwei organisch bedingte Auslöser für die oben aufgeführten Inkontinenz-Varianten vor: „Undichtigkeit“ des Harnleiterverschlusses oder Fehlsteuerungen von Muskulatur und Nervenimpulsen verursachen den Drang, sich zu erleichtern.
- Belastungsinkontinenz: Bei der Funktionsstörung des Harnröhren-Schließmuskels ist üblicherweise die Beckenbodenmuskulatur geschwächt, beispielsweise während der Schwangerschaft, infolge von Geburten oder starkem Übergewicht. Auch hormonelle oder altersbedingte organische Veränderungen kommen vor.
- Dranginkontinenz: Es gibt zwei Ausprägungen. Bei „motorischer“ Dranginkontinenz mit überaktiver Harnblase liegt eine fehlende Nervenimpuls-Hemmung zwischen Blasenmuskel und Gehirn vor, oft verursacht durch neurologische Erkrankungen. Bei der „sensorischen“ Variante mit überempfindlicher Blase hingegen melden Rezeptoren in der Blasenwand dem Gehirn fälschlich eine volle Blase. Mögliche Gründe dafür sind Blasenentzündungen oder -steine, Tumore, Östrogenmangel (Frauen) und vergrößerte Prostata (Männer).
Inkontinenz – was tun?
In vielen Fällen ist es möglich, Inkontinenz mit gezielten Maßnahmen und einem gesunden Lebensstil entgegenzuwirken.
Maßnahmen bei Belastungsinkontinenz
Bei Inkontinenz von Frauen bei körperlicher Beanspruchung trägt gezieltes Beckenbodentraining zur Stärkung des Schließmuskels bei. Bei manchen Frauen liegt aufgrund von Geburten oder aus anatomischen Gründen die Gebärmutter über der Blase. Dies wird nach ärztlicher Rücksprache gegebenenfalls operativ behandelt.
Im Fall von Übergewicht kann Ihnen eine nachhaltige Gewichtsreduktion helfen, denn die Extra-Kilos belasten den Beckenboden. Empfehlenswert ist (für beide Geschlechter) ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung und ausgewogener Ernährung. Wichtig ist zudem, viel zu trinken und nicht häufiger zur Toilette zu gehen als nötig. Faktisch kann zu häufiges Wasserlassen bei wenig gefüllter Blase Inkontinenz sogar verstärken.
Behandlung von Dranginkontinenz
Bei Dranginkontinenz in den oben geschilderten Varianten muss zunächst der eigentliche Auslöser ermittelt werden, etwa eine neurologische oder organische Erkrankung. Deren Behandlung durch (medikamentöse) Therapien oder Operationen kann die Belastungen bereits lindern oder sogar beseitigen. Unterstützend sind sogenannte „Toilettentrainings“. Hierbei lernen Sie unter ärztlicher Aufsicht, ein besseres Gefühl für Ihre Blase zu bekommen und die Ausscheidung bewusst zu kontrollieren.
Magnesium
Magnesium normalisiert die Erregungsweiterleitung der Nerven zum Gehirn und kann daher entspannend und krampflösend auf die harnaustreibende Muskulatur wirken. Sie erhalten Mineralstoffe wie Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel. Natürlich vorhanden ist es zum Beispiel in Kürbiskernen, Haferflocken, Vollkorn- und Sojaprodukten (etwa Tofu oder Milchalternativen) sowie in Nüssen.
Inkontinenz bei Frauen: Hygieneprodukte
Der spontane Harnabgang stellt im Alltag eine starke physische und psychische Belastung und Minderung der Lebensqualität dar. Wenn Sie befürchten, sich in der Öffentlichkeit einzunässen, unangenehm zu riechen oder Sie sich nicht mehr an Orte wagen, wo keine Toiletten in unmittelbarer Reichweite sind, kann Inkontinenz soziale Isolation bewirken. Lassen Sie sich von Harndrang nicht einschränken: Hygieneprodukte bei Inkontinenz schaffen Sicherheit und Abhilfe.
- Damenbinden: Viele Frauen (und Männer!) greifen diskret zu Binden oder Slipeinlagen. Das ist als Notbehelf und bei sehr schwachen Ausprägungen der Inkontinenz in Ordnung, Sie sollten es aber keinesfalls zur Regel machen. Der simple Grund: Urin und das dickflüssigere Menstruationsblut zeigen unterschiedliches Flussverhalten. Binden können Urin nicht so schnell aufsaugen und absorbieren wie nötig, es drohen daher Infektionen und Entzündungen – und unangenehme Gerüche.
- Einlagen bei Blasenschwäche: Diese Artikel sehen ähnlich aus wie Monatsbinden, ihr saugfähiger Kern ist aber eigens der Konsistenz von Urin angepasst und nimmt diesen schnell und geruchshemmend auf. Es gibt Inkontinenzeinlagen in verschiedenen Saugstärken.
- Inkontinenz-Unterwäsche: Diese Textilien sind funktional ähnlich aufgebaut wie die bereits etablierten Perioden-Slips. Verschiedene Hersteller bieten geruchabsorbierende Damen- und Herrenunterwäsche in unterschiedlichen Saugstärken an. Die Unterwäsche ist selbstverständlich waschbar, hält bei sachgemäßer Behandlung mehrere Jahre, ist damit nachhaltig und spart Ihnen bares Geld.
- Inkintinenz-Hosen: Eine weitere Alternative vor allem bei stärkerer Inkontinenz sind Einmal-Inkontinenz-Hosen. Diese sind noch saugstärker als Inkontinenz-Unterwäsche.
Fazit
Inkontinenz bei Frauen und Männern ist eine Funktionsstörung, die sich in vielen Fällen gut behandeln oder zumindest lindern lässt. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Hintergründe medizinisch abgeklärt und mit entsprechenden Therapien und gesundem Lebensstil sowie gezieltem Training ergänzt werden. Hygieneprodukte helfen im Alltag bei Inkontinenz.
FAQ
Wie oft ist Harndrang normal?
Wie oft ist Harndrang normal?
Statistisch gesehen gilt Harndrang als normal, wenn Sie tagsüber fünf- bis siebenmal Wasser lassen und in der Nacht den Schlaf nicht oder nur einmalig unterbrechen müssen.
Wie viel Urin passt in die Blase?
Wie viel Urin passt in die Blase?
Das Fassungsvermögen der Harnblase eines Erwachsenen beträgt zwischen 250 und 550 Milliliter (Frau) und 350 und 750 Milliliter (Mann). Ab etwa 300 Millilitern „Füllstand“ kommt es zum Harndrang.