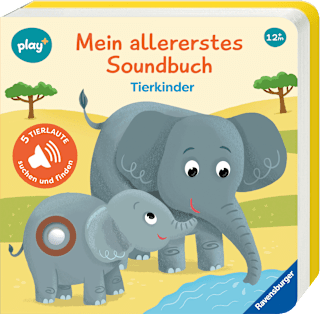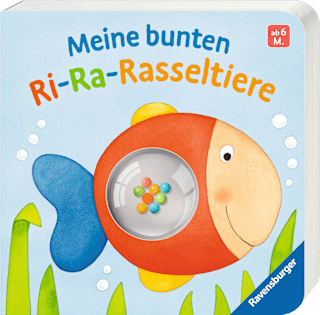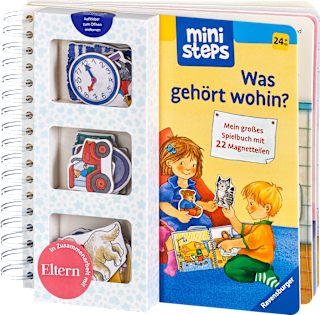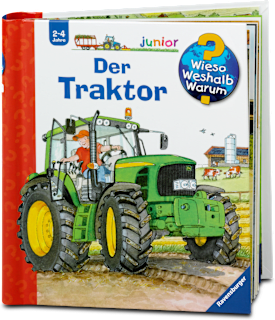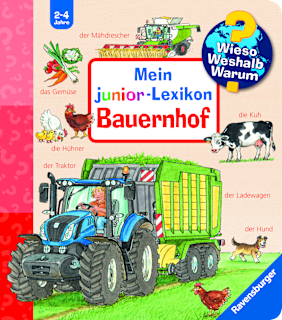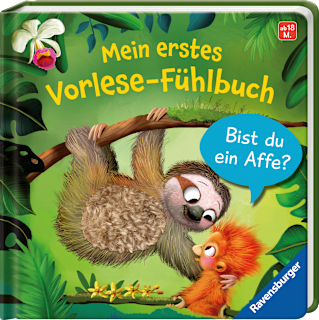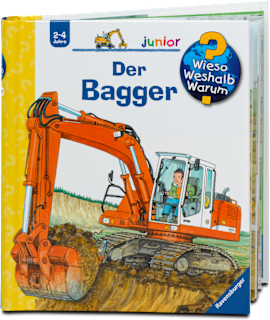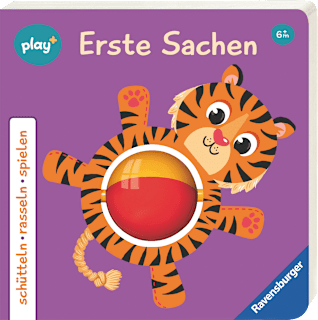Babysprache – erste Laute, erste Worte
Ganz logisch: Je mehr und ausführlicher Sie sich mit dem Baby unterhalten oder ihm vorlesen, desto besser ist das für seine Entwicklung von Sprache und Wortschatz. Doch auch die sogenannte Babysprache hat ihre Berechtigung und sogar eine wichtige Funktion für die Sprachentwicklung beim Kind. Hier erfahren Sie, was es mit „tutu“, „heia“ und „nam-nam“ auf sich hat.

dm drogerie markt
Lesedauer 5 Min.
•
10.10.2025

Was ist Babysprache?
Im Deutschen hat der Ausdruck „Babysprache“ je nach Kontext verschiedene Bedeutungen. Einerseits sind damit die dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechenden Laute gemeint, die das Baby selbst „spricht“. Außerdem bezieht sich das Wort auf eine besondere Form des Sprechens, die viele Erwachsene intuitiv gegenüber Babys verwenden. Ein alternativer, etwas präziserer Begriff in diesem Kontext lautet „Ammensprache“.
Babysprache beim Baby
Während es schon zuvor vokalartige Laute vor sich hin gebrabbelt hat, beginnt das Baby etwa mit einem halben Jahr, einzelne Laute aneinanderzureihen. Es fängt an, sie zu verdoppeln und daraus Silben zu bilden – vorerst noch ohne „Sinngehalt“. Es lauscht dabei seiner eigenen und anderen Stimmen in seiner Umgebung und lernt durch Beobachtung und Nachahmung der Mundbewegungen von Bezugspersonen, Lautkombinationen mit einem Sinn zu verbinden. Sind die ersten sinnvollen eigenen Worte gesprochen, vollzieht sich die Weiterentwicklung der Sprache in rasantem Tempo.
Sprachentwicklung bei Baby und Kleinkind
Verkürzt dargestellt, verläuft das Sprechenlernen bei der Babyentwicklung in folgenden Etappen:
- Ab dem 6. Monat: Etwa mit einem halben Jahr beginnt das Baby neben impulsiven Lautäußerungen (Schreien, Lachen) mit der Artikulation einfacher, vokallastiger Silben. Diese werden schließlich kombiniert und zu Silben gereiht.
- Ab dem 12. Monat: Die ersten echten Wörter tauchen in Babys Wortschatz auf – zunächst einfache, wichtige Begriffe wie „Mama“ oder „Papa“. Das Kind reagiert auf seinen Namen und begreift einfache Ansagen.
- Ab dem 18. Monat: Der aktive Wortschatz wächst und sollte etwa zehn bis zwanzig Worte umfassen. Das Kind kann bekannte Dinge benennen und einfache Aussagen und Aufgaben verstehen.
- Ab dem 24. Monat: Im zweiten Lebensjahr bezeichnet das Kind sich selbst mit seinem Namen und beginnt, einfache Sätze mit zwei bis drei Worten sowie Verneinungen zu bilden. Zugleich erweitert sich der Wortschatz in dieser Zeit rapide von 50 auf ungefähr 200 aktiv genutzte Wörter.
- Ab dem 30. Monat: Das Kleinkind fängt an, Pronomen („ich“, „du“, „mein“) und Artikel („der“, „die“, „das“) zu verwenden. Der Wortschatz wächst auf etwa 500 Wörter. Die Grammatik wird komplexer, ist aber nicht immer „korrekt“.
- Ab dem 36. Monat: Die Sätze werden immer länger, komplexer und berücksichtigen zum Beispiel verschiedene Zeitformen, Ein- und Mehrzahlformen und Präpositionen. Außerdem kann das Kind jetzt kleine Episoden zusammenhängend erzählen. Auch die Artikulation verbessert sich zunehmend. Zudem beginnt das Kind, Fragen zu formulieren – die bei Eltern berüchtigte „Warum?“-Phase beginnt.
Zwischen dem vierten Lebensjahr und der Einschulung schließlich steigert das Kind seinen aktiven Wortschatz von zunächst um die 2.000 bis auf etwa 5.000 Wörter. Es kann abstrakte Konzepte wie Zahlen und Farben verbal zuordnen und längere Geschichten erzählen.
Was tun bei gestörter Sprachentwicklung?
Gut zu wissen: Obige Liste gibt nur eine grobe Orientierung. Bei manchen Kindern reift die Sprache deutlich schneller, bei anderen gibt es Verzögerungen, kleine Rückschritte und schubweises Aufholen – alles ganz normal. Trotzdem sollten Sie, wenn Sie deutliche Abweichungen in der Sprachentwicklung des Kindes bemerken, in einer kinderärztlichen oder Logopädie-Praxis mögliche Ursachen abklären lassen. Verspätetes Sprechen oder schwer verständliche Aussprache kann beispielsweise organisch bedingt sein, etwa aufgrund einer unerkannten Hörschwäche.
Weshalb sprechen Erwachsene Babysprache?
Erwachsene neigen dazu, im Gespräch mit Babys in die „Ammensprache“ zu wechseln. Typisch für diese ist inhaltlich die starke Vereinfachung von Grammatik und Vokabular. Ebenso auffällig sind bei der Babysprache Erwachsener, unabhängig von der jeweiligen Muttersprache, folgende Merkmale:
- erhöhte Tonlage
- Wiederholung wichtiger Inhalte
- langsameres Sprechtempo
- veränderte Sprachmelodie
- kurze, einfache Sätze
- Gebrauch von Verkleinerungsformen
- „Vokabeln“ der Babysprache (etwa „Wauwau“ statt Hund und „Tut-tut“ statt Auto)
Durch die abweichende Sprachmelodie hebt sich die „Babysprache“ von gewöhnlicher Kommunikation ab, etwa von der, wenn Sie in Babys Beisein mit einem Erwachsenen reden. Das verleiht Babysprache einen Signaleffekt, der die Aufmerksamkeit des Babys erregt. Es antwortet darauf, indem es zurückbrabbelt und dabei seine Stimme trainiert. Antworten die Großen auf diese Weise, entwickeln sich erste „Unterhaltungen“.
Schadet Babysprache der Sprachentwicklung des Kindes?
Die Babysprache im „Dialog“ mit dem Säugling und Kleinkind hat eine wichtige kommunikative Funktion. Sie weckt das Interesse und beschäftigt das Kind, bietet also einen idealen Einstieg in das Sprechenlernen. Allerdings sollte darüber die Förderung der eigentlichen Sprache nicht ausbleiben. Sobald das Kind die ersten eigenen Worte spricht, ist es an der Zeit, Babysprache nach und nach abzulegen.
Sprachförderung nach der Babysprache
Kinder, mit denen täglich viel und in ganzen Sätzen gesprochen wird, haben klare Vorteile bei der Ausbildung der eigenen Sprache und Intelligenz. Nutzen Sie Möglichkeiten im Alltag, etwa indem Sie Handlungen kommentieren, dem Kind neue Worte für unbekannte Dinge beibringen oder seine Äußerungen aufgreifen und (gegebenenfalls korrigiert) wiederholen. Vorlesen, Geschichten erzählen und Singen sind weitere wichtige Beiträge, mit denen Sie Ihrem Kind den Zugang zur Sprache erschließen. Hervorragend geeignet sind auch altersgerechte Bilderbücher, anhand derer die Kleinen Dinge benennen können.
FAQ
Was versteht man unter Babysprache?
Was versteht man unter Babysprache?
Der Begriff „Babysprache“ bezieht sich einerseits auf die Laute des Babys, mit denen es (neben nonverbalen Gesten, Blickkontakten und dergleichen) mit seiner Umgebung kommuniziert. Zum anderen ist damit eine vereinfachte Sprachform mit veränderter Tonlage und Satzmelodie gemeint, die Erwachsene gegenüber Babys und Kleinkindern verwenden.
Wann fangen Babys mit Babysprache an?
Wann fangen Babys mit Babysprache an?
Etwa mit einem halben Jahr geben Babys Lautäußerungen von sich, die als Vorstufe von bewusster Sprachbildung gelten. Zu diesem Zeitpunkt steht das Nachahmen von Mundbewegungen für die Artikulation im Vordergrund. Die ersten „richtigen“, mit einem konkreten Sinn verbundenen Worte spricht das Baby gegen Ende des ersten Lebensjahres.
Welche Babylaute gibt es?
Welche Babylaute gibt es?
Die Australierin Priscilla Dunstan hat im Rahmen einer Studie sprach- und kulturübergreifend fünf typische „Babylaute“ ermittelt, mit denen Babys schon vor Verwendung von echter Sprache kommunizieren. Demnach steht „neh“ (mit deutlich betontem „n“) für Hunger, „eair“ für Schmerzen, „auh“ für Müdigkeit, „heh“ für Unwohlsein und ein gepresst klingendes „eh“ kündigt ein Bäuerchen an.